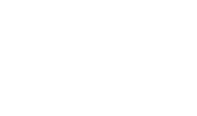Current Courses 当前课程
Wintersemester (Winter Semester) 2025/2026
VORLESUNG
China auf dem Weg zur Weltmacht. Das 20. Jahrhundert
Prof. Dr. Sabine Dabringhaus
Dienstag, 14-16 Uhr (c.t.)
Raum: KG I, Hörsaal 1199
Die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert lässt sich als eine Abfolge markanter Perioden darstellen, zwischen denen Jahre des Übergangs liegen. Auf den endgültigen Zusammenbruch des dynastischen Kaiserreichs (1911) folgte eine schwache Republik (1912-1949), deren Scheitern durch den Chinesisch- Japanischen Krieg (1937-1945) im Kontext des Zweiten Weltkriegs besiegelt wurde. Der unmittelbar daran anschließende Bürgerkrieg leitete zur Gründung des kommunistischen Parteistaats über (1949), dessen Aufstieg zur ökonomischen Globalmacht auch das 21. Jahrhundert prägt. Alle diese Zeitabschnitte – bis auf den letzten – sind von Kriegen und Aufständen, Massakern und Massenkampagnen geprägt. Hinter den ereignisgeschichtlichen Veränderungen verbergen sich zugleich Aspekte der Kontinuität wie etwa die Bindung des chinesischen Herrschaftssystems an ideologische Bekenntnisse, an eine starke Führungselite und an eine landesweite bürokratische Kontrolle. Konfuzianismus, Nationalismus, Kommunismus, Demokratisierung und Kapitalismus durchzogen Chinas 20. Jahrhundert in unterschiedlicher Gewichtung. In der Vorlesung werden die Grundlinien und Dynamiken dieses Jahrhunderts aufgezeigt, die den widersprüchlichen und komplexen Weg Chinas hin zur Gegenwart verständlich machen.
Die Vorlesung kann als Überblicksvorlesung Neueste Geschichte II (20./21. Jahrhundert) besucht werden.
Zu erbringende Studienleistungen:
- Klausur, Dauer: ca. 90 Minuten (3. Februar 2026)
- Essay: ca. 2 Seiten
Literatur:
- Mühlhahn, Klaus: Geschichte des Modernen China: Von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart. München 2021.
- Lü, Peng: A History of China in the 20th Century. Singapore 2023.
- Spence, Jonathan D.: Chinas Weg in die Moderne. München 2001.
- Wasserstrom, Jeffrey N. (Hrsg.): The Oxford Illustrated History of Modern China. Oxford 2016.
HAUPTSEMINAR
Chinesische Geschichte in Bildern
Prof. Dr. Sabine Dabringhaus
Donnerstag,16-18 Uhr (c.t.)
Raum: KG IV, Übungsraum 2
Bilder prägen unsere Vorstellungen von der Welt und ihrer gesellschaftlichen Institutionen. Sie sind Ausdruck des Verhaltens zur Realität, können dieses aber auch beeinflussen. Die Produktion und Rezeption von Bildern unterliegen jeweils zeitbedingten Kontexten. In der Geschichtswissenschaft haben Bildquellen als Kommunikationsmittel und Instanzen der Wahrheitsproduktion wie auch Wissensvermittlung, als Propaganda, Dekoration oder Vehikel der Weltaneignung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies gilt sowohl für die verschiedenen Zweige der Kunst wie etwa Malerei, Zeichnung und Graphik und auch für die Fotografie. Die Historische Bildforschung untersucht die historischen Bedingtheiten und Bedeutungen der verschiedenen Bildmedien und ihrer Wahrnehmung sowie ihre gesellschaftliche, kulturelle und soziale Rolle in sich wandelnden zeitlich-räumlichen Konstellationen. Die Geschichte Chinas in der Neuzeit – vom späten Kaiserreich bis zur sozialistischen Moderne - bietet hierfür hervorragendes Anschauungsmaterial.
Zu erbringende Prüfungsleistung:
- Das Abgabedatum für die Hausarbeit (20–25 Seiten) ist der 1. April 2026.
- Mündliche Prüfungen (20 Minuten) nach individueller Absprache, i.d.R. zwischen dem 09. Februar und dem 10. April 2026.
Zu erbringende Studienleistungen:
- Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)
- Klausur (Dauer: ca. 90 Minuten)
- Referat/mündliche Präsentation (Dauer: ca. 10 Minuten)
- Thesenpapier (Umfang: ca. 1 Seite)
- Essay (Umfang: ca. 3 Seiten)
- Leseprotokoll (Umfang: ca. 1 Seite)
Literatur:
- Yi, Gu: "What’s in a Name? Photography and Reinvention of Visual Truth in China, 1840-1911“, in: The Art Bulletin, March 2013, vol. 95, 120–138.
- Jäger, Jens: Photographie: Bilder der Neuzeit: Einführung in die Historische Bildforschung. Tübingen 2000.
- Paul, Gerhard (Hrsg.): Visual History: Ein Studienbuch. Göttingen 2006.
HAUPTSEMINAR
Geschichte Taiwans
Prof. Dr. Sabine Dabringhaus
Dienstag, 10–13 Uhr (c.t.)
Raum: KG IV, Übungsraum 2
Nirgendwo ist eine direkte, gewaltsame Konfrontation zwischen den beiden Weltmächten China und USA wahrscheinlicher als in der Taiwanstraße. Für die Volksrepublik China ist Taiwan nur eine „abtrünnige Provinz“, die mit dem Festland wiedervereinigt werden muss. Für die USA ist die Insel ein wichtiger Militärstützpunkt in Ostasien und Symbol ihrer Machtansprüche im Pazifischen Raum. Vor diesem brisanten aktuellen Hintergrund wollen wir im Seminar die wechselvolle Geschichte Taiwans zurückverfolgen. Die Kolonialzeit begann um 1583, als portugiesische Fernhändler als erste Europäer die Insel erreichten und ihr den Namen „Ilha Formosa“ („die schöne Insel“) gaben. Mit Taiwans Kolonisierung durch die niederländische Handelskompagnie und die spanische Kolonialmacht in den 1620er Jahren begann zugleich die Geschichte der chinesischen Migration. 1684 gliederte die Qing-Dynastie Taiwan in ihr sino-mandschurisches Vielvölkerimperium ein. Eine erste Phase umfassender Modernisierung fiel in die Zeit der japanischen Kolonialherrschaft (1895-1945). Staatliche Souveränität erhielt Taiwan 1949 nach der Flucht der nationalchinesischen Guomindang-Regierung vor den Kommunisten Mao Zedongs auf die Insel. Es folgten Jahrzehnte der Diktatur. Erst die Aufhebung des Kriegsrechts von 1987 und die Wahl eines Präsidenten, der nicht der GMD angehörte, signalisierten einen vorsichtigen Wandel in Richtung Demokratie. Der aktuelle, sich zuspitzende Konflikt um Taiwan lässt sich nur vor diesem historischen Hintergrund verstehen.
Zu erbringende Prüfungsleistung:
- Das Abgabedatum für die Hausarbeit (20–25 Seiten) ist der 1. April 2026.
- Mündliche Prüfungen (20 Minuten) nach individuellen Absprache, i.d.R. zwischen dem 09. Februar und dem 10. April 2026.
Zu erbringende Studienleistungen:
- Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)
- Klausur (Dauer: ca. 90 Minuten)
- Referat/mündliche Präsentation (Dauer: ca. 10 Minuten)
- Thesenpapier (Umfang: 1 Seite)
- Essay (Umfang: ca. 2–3 Seiten)
- Leseprotokoll (Umfang: ca. 1 Seite)
Literatur:
-
Alsford, Niki J. P.: Taiwan Lives: A Social and Political History. Seattle, Washington 2024.
-
Brown, Melissa J.: Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities,Berkeley / Los Angeles 2004.
- Copper, John F.: Historical Dictionary of Taiwan. Lanham / Boulder 2025.
- Schubert, Gunter: Kleine Geschichte Taiwans. München 2024.
- Schubert, Gunter (Hrsg.): Routledge Handbook of Contemporary Taiwan. New York 2025.
- Thome, Stephan. Schmales Gewässer, gefährliche Strömung: Über den Konflikt in der Taiwanstraße. Berlin 2024.
PROSEMINAR
Von der Sinophilie zur Sinophobie? China im Wandel der westlichen Wahrnehmung zwischen der Qing-Dynastie und der Republik
Royston Lin
Montag,14-17 Uhr (c.t.)
Raum: Peterhof, Raum 2
Die sino-europäischen Beziehungen erstrecken sich über mehrere Jahrhunderte, doch die westlichen Wahrnehmungen Chinas waren nie konstant. Einst galt China als sagenumwobenes Land im „Fernen Osten“, bekannt für seine hochentwickelte Kultur und seinen immensen Reichtum, und wurde lange Zeit als ebenbürtig
– wenn nicht gar überlegen – gegenüber dem Westen angesehen. Dieses idealisierte Bild begann jedoch zu bröckeln, als die Spannungen zunahmen. Von dem langwierigen Ritenstreit im 17. und 18. Jahrhundert bis hin zu einer Reihe militärischer Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert verschlechterte sich das Verhältnis zunehmend. Das sogenannte „Jahrhundert der Demütigung“ endete nicht mit dem Sturz der Qing-Dynastie (1644–1911). Auch während der Republikzeit (1911–1949) hielt sich im Westen das Bild eines schwachen und zersplitterten China. Gleichzeitig begann jedoch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine allmähliche Annäherung zwischen China und Europa.
Dieses Proseminar verfolgt einen chronologischen Ansatz und bietet einen Überblick über die sino- europäischen Beziehungen von der Qing-Dynastie bis in die republikanische Ära. Anhand ausgewählter historischer Fallbeispiele wird der Wandel westlicher China-Bilder nachvollzogen. Ziel des Seminars ist es, durch die Analyse dieser bedeutenden Interaktionen ein vertieftes Verständnis für die historischen Hintergründe zu entwickeln, die die ambivalenten Beziehungen zwischen China und dem Westen bis in die Gegenwart prägen.
* Eigenständige Arbeitsweise und die Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte werden vorausgesetzt. Chinesischkenntnisse sind nicht erforderlich.
Zu erbringende Prüfungsleistung:
- Das Abgabedatum für die Hausarbeit (12–15 Seiten) ist der 13. März 2026.
- Mündliche Prüfungen (20 Minuten) i.d.R. zwischen dem 28. Juli und dem 10. Oktober 2025
Zu erbringende Studienleistungen:
- Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)
- Klausur (Dauer ca. 90 Minuten
- Referat/mündliche Präsentation (Dauer: ca. 10-15 Minuten,
- Essay (Umfang: ca. 2 Seiten)
- Teilnahme an der Seminardebatte (ca. 75 Minuten)
Literatur:
- Hopwood, Nick/Flemming, Rebecca/Kassell, Lauren (Hrsg.): Reproduction. Antiquity to the Present Day, Cambridge 2018.
- Birke, Roman: Kleine Geschichte der modernen Reproduktionspolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 43–44 (2024), S. 11–16.
- Marland, Hillary/Rafferty, Anne Marie (Hrsg.): Midwives, Society and Childbirth. Debates and Controversies in the Modern Period, London 1997.
KOLLOQUIUM
Forschungs- und Doktorandenkolloquium: Ostasiatische Geschichte
Prof. Dr. Sabine Dabringhaus
Dienstag, 16-18 Uhr (c.t.)
Raum: KG IV, Übungsraum 2
Das Kolloquium wendet sich an Masterstudent/innen und Doktorand/innen. Es sollen Abschlussarbeiten der Teilnehmer/innen vorgestellt und an Han jüngerer wissenschaftlicher Publikationen zentrale Forschungsfragen diskutiert werden. Ergänzt wird das Programm durch einzelne Gastvorträge.
Zu erbringende Studienleistungen:
- Regelmäßige Teilnahme
- Protokoll (Umfang 1–2 Seiten)
Hier finden Sie die Liste der Vorträge.